Erbvertrag im Erbrecht
Alles rund um den notariellen Erbvertrag
Inhalt zu den Infos
1. Grundsätze zum notariellen Erbvertrag
2. Überblick über die Rechtsnatur von einem notariellen Erbvertrag
3. Wirksamkeitserfordernisse bei einem Erbvertrag
4. Regelungsinhalte in Erbverträgen
Grundsätze zum notariellen Erbvertrag
Der Erbvertrag ist in §§ 1941, 2274 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt.
Anders als ein Einzeltestament oder ein gemeinschaftliches Testament, welche beide in wirksamer Weise auch eigenhändig bzw. handschriftlich errichtet werden können, bedarf die Errichtung eines
Erbvertrags zur Wirksamkeit stets einer Beurkundung durch einen Notar. Hierzu ist es notwendig, dass sämtliche Vertragsparteien des Erbvertrags bei dessen
Abschluss gleichzeitig vor dem Notar persönlich anwesend sind, ohne dass sie sich hierbei vertreten lassen können.
Ein Erbvertrag beinhaltet eine in Vertragsform errichtete letztwillige Verfügung, welche regelmäßig zu einer Bindungswirkung führt. Anders als Testamente ist ein Erbvertrag grundsätzlich nicht
widerruflich, mit der Folge, dass der oder die hierin Testierenden hieran nach dem Abschluss des Erbvertrags gebunden sind, wonach der oder die Erblasser danach nicht mehr hiervon abweichend
testieren können, nachdem sie in ihrer Testierfreiheit beschränkt sind. Ein Rücktritt vom Erbvertrag oder eine Aufhebung des Erbvertrags ist ungeachtet einer möglichen Anfechtung
des Erbvertrags beim Vorliegen von Anfechtungsgründen nur noch dann möglich, wenn sämtliche Vertragsparteien hieran mitwirken oder sie sich dies bei Vertragsschluss ausdrücklich vorbehalten
haben.
Ein Erbvertrag kann sowohl als einseitiger Erbvertrag, wie auch als zweiseitiger Erbvertrag ausgestaltet werden. In einem einseitigen Erbvertrag trifft lediglich
einer der Vertragsparteien eine vertraglich bindende Verfügungen von Todes wegen. Bei einem zweiseitigen Erbvertrag treffen hingegen beide Vertragsparteien bindende Verfügungen von Todes wegen.
Zweiseitige Erbverträge werden regelmäßig zwischen verheirateten Ehegatten geschlossen. Allerdings ist die Wirksamkeit eines zwischen Ehegatten geschlossenen zweiseitigen Erbvertrags vom Bestand
der Ehe abhängig, wonach die hierin getroffenen vertragsmäßigen Verfügungen grundsätzlich mit Scheidung der Ehe unwirksam werden; dies gilt bereits dann, wenn die Voraussetzungen
der Scheidung beim Erbfall, also beim Tod eines Ehegatten bereits erfüllt waren und dieser rechtzeitig einen Scheidungsantrag gestellt hatte.
Wie bei der notariellen Beurkundung eines öffentlichen (notariellen) gemeinschaftlichen Testaments fallen auch für die notarielle Beurkundung eines Erbvertrags ggf. nicht
unerhebliche Kosten an und zwar gem. Nr. 21200 Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) eine 2,0 Gebühr nach dem zusammengerechneten Reinvermögen der hierin testierenden Personen.
Überblick über die Rechtsnatur von einem notariellen Erbvertrag
Eine Legaldefinition für den notariellen Erbvertrag findet sich in § 1941 Abs.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Nach dem dortigen Inhalt kann der testierende Erblasser durch Vertrag entweder einen Erben einsetzen, Vermächtnisse und Auflagen anordnen sowie das anzuwendende Erbrecht wählen.
Einem einzelnen Erblasser stehen insgesamt drei Möglichkeiten für die Errichtung einer letztwilligen Verfügung zur Seite, während gemeinsam testierenden Ehegatten oder
eingetragenen Lebenspartnern hierfür insgesamt fünf verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stehen. So kann von einem einzeln testierenden Erblasser entweder ein privatschriftliches bzw.
handschriftliches (Einzel-)Testament oder ein notarielles (Einzel-)Testament oder ein notarieller Erbvertrag errichtet werden, während Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner darüber hinaus
auch noch die Möglichkeit haben, ein privatschriftliches bzw. handschriftliches gemeinschaftliches Testament oder ein notarielles gemeinschaftliches Testament zu errichten.
Während ein privatschriftliches bzw. handschriftliches oder ein notarielles (Einzel-)Testament eines hierin allein Testierenden gem. § 1937 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) eine einseitige Verfügung von Todes wegen
darstellt, welche von ihm gem. § 2253 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) jederzeit widerrufen oder abändern kann, führen sowohl gemeinschaftliche Testamente von Ehegatten
oder eingetragenen Lebenspartnern, wie auch Erbverträge, in der Regel zu einer sog. „Bindungswirkung“, mit der Folge, dass gemeinschaftliche Testamente nach dem Tod des Erstversterbenden und
Erbverträge bereits mit ihrer wirksamen Errichtung von einem der Testierenden regelmäßig allein nicht mehr geändert werden können, sofern keine sog. „Befreiungsanordnungen“, nämlich Ausnahmen von
den Bindungswirkungen, getroffen wurden.
Ein Erbvertrag kommt als Vertrag gem. § 145 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) durch übereinstimmende Willenserklärungen der Vertragsparteien zustande. Gem. § 1941 Abs.2 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) können in einem
Erbvertrag als Erben bzw. Vertragserben oder als Vermächtnisnehmer sowohl die anderen am Vertrag mitwirkenden Vertragsparteien, als auch dritte Personen bedacht werden.
Mit dem wirksamen Zustandekommen eines Erbvertrags hat der hierin bestimmte Vertragserbe zunächst noch keinen gegenwärtig schuldrechtlich durchsetzbaren und auf den Erhalt des
Nachlass des Erblassers zu dessen Lebzeit gerichteten Anspruch. Der Anspruch des Vertragserben auf den Nachlass entsteht erst mit Eintritt des Erbfalls durch das Ableben des Erblassers.
Vertragsmäßige und einseitige Verfügungen von Todes wegen im Erbvertrag
Gem. § 2278 Abs.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) kann in einem Erbvertrag jeder der Vertragschließenden vertragsmäßige Verfügungen von Todes wegen treffen. Allerdings bestimmt § 2278
Abs.2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), dass andere Verfügungen als Erbeinsetzungen, Vermächtnisse, Auflagen und die Wahl des anzuwendenden Erbrechts in
einem Erbvertrag vertragsmäßig nicht getroffen werden können.
An vertragsmäßige Verfügungen eines Vertragsschließenden in einem Erbvertrag ist dieser gem. §§ 2290 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) regelmäßig gebunden.
Andere Verfügungen von Todes wegen, wie z.B. eine Enterbung oder Teilungsanordnung, können in einem Erbvertrag nicht in vertragsmäßiger und damit nicht in bindender Weise getroffen werden;
gleichwohl ist es jedoch möglich, in einen Erbvertrag auch einseitige Verfügungen von Todes wegen aufzunehmen, ohne dass diese allerdings zu einer Bindungswirkung führen und insoweit jederzeit
frei widerruflich sind.
Gem. § 2289 Abs.1 S.2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) wird durch den Erbvertrag eine frühere letztwillige Verfügung des Erblassers aufgehoben, soweit sie das Recht des
vertragsmäßig Bedachten beeinträchtigen würde; im gleichen Umfang ist eine spätere Verfügung von Todes wegen unwirksam.
Wirksamkeitserfordernisse bei einem Erbvertrag
Ein Erbvertrag darf zur Wirksamkeit gem. § 2274 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) von dem Erblasser, welcher hierin Verfügungen von Todes wegen trifft, nur (höchst-)persönlich geschlossen
werden. Damit kann sich der Erblasser bei der Schließung des Erbvertrags nicht durch eine andere Person vertreten lassen. Eine andere an der Schließung des Erbvertrags mitwirkende Vertragspartei,
welcher hierin keine eigenen Verfügungen von Todes wegen trifft, kann sich dagegen bei der Vertragsschließung durchaus durch Dritte vertreten lassen, ohne dass dies der Rechtswirksamkeit
berührt.
Ferner ist es zur Wirksamkeit des Erbvertrags gem. § 2275 Abs.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) erforderlich, dass sich der hierin testierende Erblasser zum Zeitpunkt des Zustandekommens noch in einem unbeschränkt
geschäftsfähigen Zustand befindet. Geschäftsunfähig ist gem. § 104 Nr.1, Nr.2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) derjenige, der nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat oder der sich in einem die freie
Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist. Insoweit kommt es beim Erbvertrag
im Gegensatz zu Testamenten nicht nur auf die Testierfähigkeit des Testierenden zum maßgeblichen Zeitpunkt an, welche gem. 2229 Abs.4 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) bei demjenigen nicht mehr gegeben ist, der
wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen Bewusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von ihm abgegebenen
Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln, sondern es muss zudem auch noch eine Geschäftsfähigkeit bestehen.
Im Übrigen bedarf der Erbvertrag zur Wirksamkeit gem. § 2276 Abs.1 S.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) grundsätzlicher der notariellen Beurkundung, wonach er regelmäßig nur bei gleichzeitiger persönlicher Anwesenheit
aller Vertragsparteien vor dem beurkundenden Notar rechtswirksam geschlossen werden kann.
Regelungsinhalte in Erbverträgen
In einen Erbvertrag können nach gem. § 2299 Abs.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) neben vertragsmäßigen Verfügungen auch einseitige Verfügungen von Todes wegen aufgenommen werden; derartige
einseitige Verfügungen führen allerdings zu keiner Bindungswirkung und sind gem. § 2253 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) jederzeit frei widerruflich, da auf diese gem. § 2299 Abs.2 S.1 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB) die Vorschriften für das Testament
Anwendung finden.
Insoweit wird nach den möglichen unterschiedlichen Regelungsinhalten in einem Erbvertrag zwischen einem einseitigen Erbvertrag, einem einseitigen (teil-)entgeltlichen Erbvertrag und einem
gegenseitigen Erbvertrag unterschieden, mit der Maßgabe, dass Erbverträge zwar mindestens von mindestens zwei Personen geschlossen werden müssen ab auch von beliebig vielen
Personen geschlossen werden können.
Einseitiger Erbvertrag
In einem einseitigen Erbvertrag trifft nur eine der hieran als Vertragsschließende beteiligten Personen eine Verfügung von Todes wegen.
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn zwischen einem Elternteil und einem von dessen Abkömmlingen ein Erbvertrag errichtet wird, in welchem zwar der Elternteil den betreffenden Abkömmling
zum Alleinerben beruft, der zum Alleinerben berufene Abkömmling seinerseits in dem Erbvertrag jedoch keine eigene Verfügung von Todes wegen trifft und keinerlei Verpflichtungen übernimmt.
Einseitiger (teil-)entgeltlicher Erbvertrag
Bei einem einseitigen (teil-)entgeltlichen Erbvertrag trifft ebenfalls nur einer der Vertragsschließenden eine Verfügung von Todes wegen. Allerdings verpflichte sich die andere
Vertragspartei im Gegenzug zur i.d.R. lebzeitigen Erbringung von Gegenleistungen.
Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn ein Elternteil einen von dessen Abkömmlingen in einem von beiden errichteten Erbvertrag zum Alleinerben beruft, sich der erbende Abkömmling jedoch im
Gegenzug dazu verpflichtet, lebzeitige Pflegeleistungen zugunsten des Elternteils zu erbringen oder im Erbfall über einen näher bestimmten und längeren Zeitraum die Grabpflege über die
Grabanlage, in welcher der Elternteil beigesetzt wurde, zu übernehmen.
Gegenseitiger Erbvertrag im Erbrecht
Bei einem gegenseitigen Erbvertrag, welcher im Erbrecht der Regelfall ist, wird von jedem der Vertragschließenden gleichzeitig eine Verfügung von Todes wegen zugunsten des
jeweils anderen Vertragschließenden getroffen.
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn zwischen zwei Ehegatten ein Erbvertrag errichtet wird, in welchem sich die Ehegatten wechselseitig zu Erben einsetzen, wonach der
Erstversterbende vom längerlebenden Ehegatten allein beerbt wird oder darüber hinaus gemeinsam einen oder mehrere Schlusserben nach den Tod des Längstlebenden bestimmen.
Rechtsfolgen aus einem Erbvertrag im Erbrecht
Durch einen wirksam geschlossenen Erbvertrag wird der hierin vom Erblasser für den Erbfall bei dessen Tod vertragsmäßig Bedachte gem. § 2289 Abs.1 S.1, S.2 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB) in seiner Stellung als
(Vertrags-)Erbe im Erbrecht sowohl gegen frühere, wie auch gegen spätere und seine Rechte beeinträchtigen letztwilligen Verfügungen des Erblassers geschützt, wonach der Erblasser
nicht mehr in einer vom Erbvertrag abweichenden Weise von Todes wegen Verfügen darf, sofern ihm dies nicht ausnahmsweise im Zuge einer sog. „Befreiungsanordnung“ nachgelassen worden ist.
Der Erblasser kann jedoch gem. § 2286 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) weiterhin über sein Vermögen durch Rechtsgeschäft unter Lebenden frei verfügen und ist durch den Erbvertrag
lediglich in seiner Testierfreiheit beschränkt.
Missbraucht der Erblasser allerdings dieses ihm weiterhin zustehende Recht zur Vornahme von lebzeitigen Verfügungen in der Absicht, den Vertragserben dadurch zu beeinträchtigen und wendet er
unter Beeinträchtigungsabsicht ohne ein billigenswertes lebzeitiges Eigeninteresse sein Vermögen ganz oder teilweise schenkungsweise Dritten zu, kann der
Vertragserbe gem. § 2287 Abs.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) von dem Beschenkten die Herausgabe des Geschenks verlangen, nachdem dem Vertragserben die Erbschaft nach dem Erbfall
ihm angefallen ist.
Rücktritt vom Erbvertrag
Erblasser, welche in einem Erbvertrag Verfügungen von Todes getroffen haben, können von dem notariell beurkundeten und damit formwirksam errichteten Erbvertrag gem. § 2293 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nur dann im Nachhinein zurücktreten, wenn Sie sich hierin den Rücktritt ausdrücklich vorbehalten haben. In diesem Fall steht den jeweiligen Erblassern ein Rücktrittsrecht jedoch nur (höchst-)persönlich zu, ohne dass hierbei eine Vertretungsmöglichkeit durch Dritte besteht.
Ein Rücktrittsvorbehalt kann sich entweder nur auf einzelne vertragsmäßige Verfügungen beschränken oder die sämtlichen erbvertraglichen Verfügungen insgesamt erfassen. So kann sich beispielsweise ein Erblasser ein Rücktrittsrecht vom Erbvertrag für den Fall vorbehalten, wenn der hierin eingesetzte Vertragserbe einer von diesem vertraglich übernommenen Pflegeverpflichtung in Bezug auf den Erblasser nicht oder nicht hinreichend nachkommen sollte.
Neben etwaigen im Erbvertag vorbehaltenen vertraglichen Rücktrittsrechten, kann darüber hinaus ggf. auch ein gesetzliches Rücktrittsrecht in Betracht kommen. Ein derartiges gesetzliches Rücktrittsrecht besteht in jedoch nur in zwei gesetzlich geregelten Fällen.
Ein derartiger Rücktritt setzt zum einen schwere sittliche Verfehlungen des Bedachten gem. § 2294 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) voraus. Danach kann der Erblasser kann von einer vertragsmäßigen Verfügung in einem Erbvertrag dann zurücktreten, wenn sich der Bedachte einer Verfehlung schuldig macht, die den Erblasser zur Entziehung des Pflichtteils berechtigt oder falls der Bedachte nicht zu den Pflichtteilsberechtigten gehört, zu der Entziehung berechtigen würde, wenn der Bedachte ein Abkömmling des Erblassers wäre. Eine Verfehlung i.S.v. § 2294 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ist gem. 2333 Abs.1 Nr.2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) insbesondere dann anzunehmen, wenn sich der begünstigte Vertragserbe eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegen dem Erblasser, dem Ehegatten des Erblassers, einem anderen Abkömmling oder einer dem Erblasser ähnlich nahe stehenden Personen schuldig macht.
Zum anderen besteht ein gesetzliches Rücktrittsrecht gem. § 2295 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) auch bei der Aufhebung einer Gegenverpflichtung des Bedachten, wonach der Erblasser kann von einer vertragsmäßigen Verfügung in einem Erbvertrag dann zurücktreten kann, wenn die Verfügung mit Rücksicht auf eine rechtsgeschäftliche Verpflichtung des Bedachten, dem Erblasser für dessen Lebenszeit wiederkehrende Leistungen zu entrichten, insbesondere Unterhalt zu gewähren, getroffen ist und die Verpflichtung vor dem Tode des Erblassers aufgehoben wird.
Gem. § 2296 Abs.2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) muss der Rücktritt gegenüber dem jeweiligen anderen Vertragschließenden aus dem Erbvertrag unter förmlicher Zustellung an diesen erfolgen und bedarf im Übrigen zur Formwirksamkeit im Vorfeld der notariellen Beurkundung.
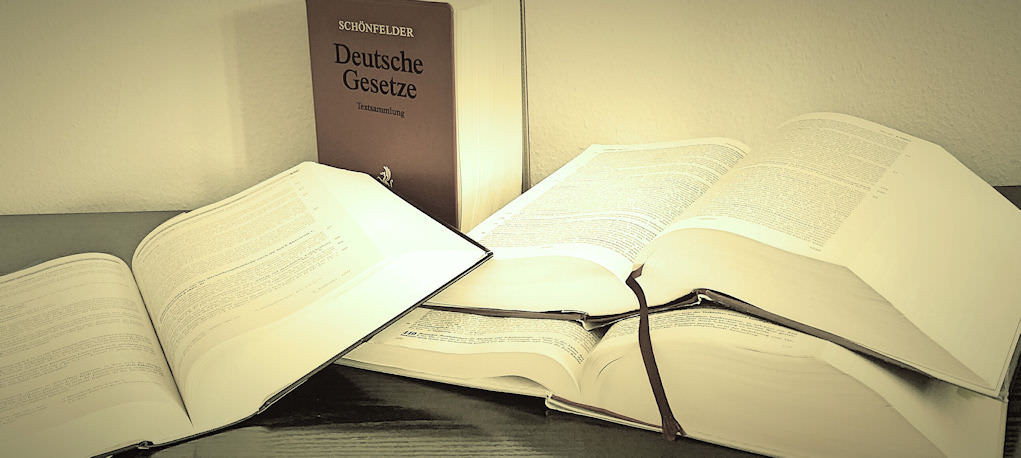 Anwaltskanzlei Denzinger & Coll.
Anwaltskanzlei Denzinger & Coll.Ihr Rechtsanwalt in Augsburg
86150 Augsburg
Bayern DE
Telefon: +49 (0)821 510747
Telefax: +49 (0)821 510700
E-Mail: ra.denzinger@t-online.de
48.368217 10.892099

Beiträge aus dem Blog:
-
26.05.2022 Neue Kammer für Erbsachen
- 01.08.2018 beA geht wieder online
- 25.05.2018 Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- 15.04.2018 Rechtsanwalt Rainer Denzinger im TV
- 18.12.2015 Massenentlassung bei ALSO
- 08.10.2015 Einsatz verdeckter Ermittler
- 11.09.2015 Pilotenstreik untersagt
- 21.08.2015 EU-ErbRVO regelt neues Erbrecht
Bewertungen von Rechtsanwalt Rainer Denzinger unter anwalt.de
Rezensionen von Anwaltskanzlei Denzinger & Coll. unter Google
Gesamte Bewertungen ★★★★★ (sehr gut) 4,7 von 5 Sternen bei 90 Rezensionen insgesamt
Folgen und besuchen auf:
Seite empfehlen und teilen mit:
Inhalt von Seiten durchsuchen:
Gesamte Website durchsuchen:
© 2025 Anwaltskanzlei Denzinger & Coll. - Ihr Rechtsanwalt und Fachanwalt in Augsburg


